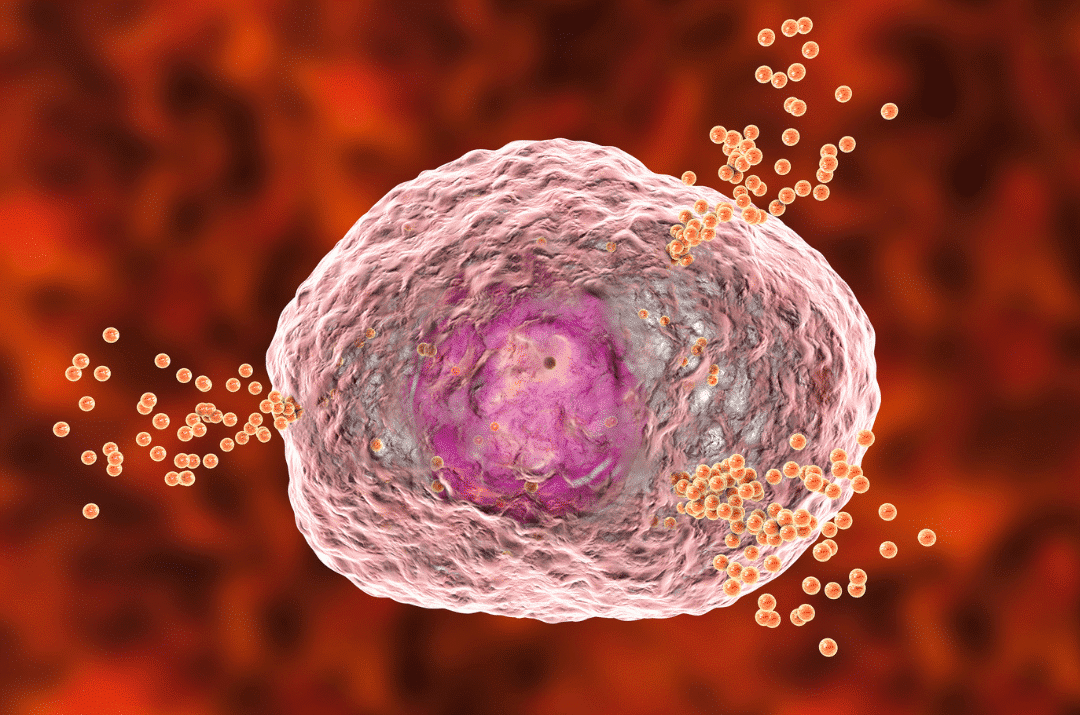
Interview mit Prof. Molderings zu Mastzellerkrankungen
Inhaltsverzeichnis
Vorstellung
Apl. Prof. Dr. med. Gerhard J. Molderings ist Mastzellimmunologe, Molekulargenetiker und Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie.
An dieser Stelle möchte ich mich für die sehr informative Korrespondenz bedanken. Es hat mich sehr gefreut die Möglichkeit für ein solches Experteninterview zu erhalten.
Komorbiditäten bei Mastzellerkrankungen
Welche eigenständigen Erkrankungen (Komorbiditäten) können häufig mit einer systemischen Mastzellerkrankung (MCAD) gemeinsam auftreten?
Prof. Molderings: Das gleichzeitige Vorkommen von zwei oder mehr verschiedenen Erkrankungen bei einer Patientin oder einem Patienten wird als Komorbidität bezeichnet. Bei den Komorbiditäten handelt es sich also um jeweils eigenständige Erkrankungen. Bei der MCAD fällt die Abgrenzung zwischen Komorbidität und Symptomatik als Folge der MCAD schwer, da die Symptomatik einer Komorbidität häufig mit der Symptomatik der MCAD überlappen. Mir ist keine methodisch saubere systemische Untersuchung zu dieser Frage bekannt. Prof. Afrin hat 2017 versucht, an einer MCAD-Patientengruppe mit 413 Patienten Komorbiditäten herauszuarbeiten.
Darüberhinaus gibt es weitere Komorbiditäten wie Allergien, Autoimmunerkrankungen oder Autismus-Spektrum-Erkrankungen, die von anderen Untersuchergruppen zusammengestellt wurden und in der Patientengruppe von Prof. Afrin offensichtlich nicht vorhanden waren.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Link führt zur oben genannten Arbeit von Prof. Afrin. Darin finden sich Tabellen, die sich u.a. mit der Häufigkeit von Komorbiditäten beschäftigen. Dazu zählen z.B. Gastroösophageale Refluxkrankheit GERD (Häufigkeit 35 %), Bluthochdruck (29 %), Multiple/atypische Arzneimittelreaktionen (23 %), Schilddrüsenunterfunktion (17 %) und Fibromyalgie (16 %). Zudem gibt es noch weitere sehr interessante Tabellen, wie z.B. ein Auflistung mit der Häufigkeit von Symptomen beim Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS). Darunter u.a. Erschöpfung (Häufigkeit 83 %), Parästhesien (58 %), Übelkeit/ Erbrechen (57 %), Fieber (40 %) und Angst/Panik (16 %).
Vererbung von Mastzellerkrankungen
Bei vielen Betroffenen zeigen sich in der nahen Verwandtschaft ähnliche Hypersensitivitäten bzw. ähnliche Symptomatik. Ist ein Mastzellaktivierungssyndrom vererbbar?
Prof. Molderings: Untersuchungsergebnissen der letzten Jahre zur Genetik der Erkrankung legen die Vorstellung nahe, dass die MCAD eine polygene multifaktorielle Krankheitsentität ist. Sie ist dadurch gekennzeichnet ist, dass eine bestenfalls ansatzweise definierte generationsübergreifend (der medizinische Begriff ist „transgenerational“) übertragene epigenetische Erkrankung zu individuellen epigenetischen Störungen führt, die dann sekundäre genetische Veränderungen, sowohl somatische Mutationen als auch Keimbahnmutationen in einer Vielzahl von Genen induzieren. Die Erkrankung wird somit nicht im klassischen Sinne vererbt, so dass auch die Mendelschen Vererbungsregeln nicht gelten, sondern kann von Generation zu Generation übertragen werden.
Salicylatintoleranz und Mastzellerkrankung
Bei Mastzellerkrankungen kann nicht selten auch eine Salicylatintoleranz bestehen. Gibt es die Salicylatintoleranz auch als eigenständige Erkrankung ohne die Mastzellaktivierung?
Prof. Molderings: Ja, die gibt es. Allerdings ist es häufig auch in diesem Fall schwierig für den individuellen MCAD-Patienten herauszuarbeiten, ob eine Salicylatintoleranz eine eigenständige Erkrankung oder ein Symptom der MCAD ist.
Provokationstests bei Mastzellerkrankungen
Menschen mit einer Mastzellerkrankung können nicht nur auf Lebensmittel reagieren, sondern z.B. auch auf Duftstoffe. Nicht selten wird in solchen Fällen für die Diagnostik ein Provokationstest angeordnet, bei dem vorab Antihistaminika abgesetzt werden sollen. Ist dieses diagnostische Vorgehen bei einer Mastzellerkrankung empfehlenswert?
Prof. Molderings: Ich persönlich würde nicht so vorgehen in der Diagnostik. Durch Absetzen der MCAD-Medikation kommt es zum einen fast regelhaft zu einer im günstigen Fall vorübergehenden Verschlimmerung der Erkrankung. Zum anderen sind während dieser Absetzphase die Mastzellen übererregbarer als unter Behandlung. Ein Provokationstest kann daher eine ausgeprägte Mastzellaktivierung bis hin zu anaphylaktoiden Reaktionen auslösen. Nach meiner Erfahrung kann ein Provokationstest auch unter bestehender Therapie durchgeführt werden, weil durch die Therapie die Mastzellen nicht komplett abgeschaltet werden, sondern nur in ihrer Aktivität reduziert werden. Nach Provokation läßt sich im positiven Fall eine Mastzellreaktion verzeichnen. Sie fällt natürlich schwächer aus als nach Absetzen der Therapie, kann dadurch aber auch effektiver wieder durch vorübergehende zusätzliche Medikation behandelt werden.
Mastzellbotenstoffe und Therapie
Bei einer Mastzellerkrankung wird häufig nur über das „prominente“ Histamin gesprochen bzw. über eine Therapie mit Antihistaminika. Dabei können Mastzellen noch viele weitere Botenstoffe ausschütten. Wie viele Mastzellbotenstoffe sind derzeit bekannt?
Prof. Molderings: In einer systematischen Untersuchung 2023 konnten 390 intrazelluläre Substanzen als potenzielle, durch Exozytose freisetzbare Botenstoffe identifiziert werden. Neben der Exoxytose, also vereinfacht gesagt, der Freisetzung durch Degranulation, gibt es aber noch mehrere weitere Mechanismen, mit deren Hilfe die Mastzelle intrazelluläre Substanzen inklusive genetischem Material an andere Zellen weitergeben kann. Daher ist es theoretisch möglich, dass alle Substanzen, die eine Mastzelle herstellen kann, unter bestimmten Umständen auch als Botenstoffe wirken können.
Kann es Patientenfälle geben, bei denen Antihistaminika nicht ausreichen könnten, weil möglicherweise andere Mastzellbotenstoffe vorherrschend sind?
Prof. Molderings: Histamin ist nur einer der unermeßlichen Zahl von potenziellen Mastzellbotenstoffen, so dass bei der Mehrheit der Patienten durch eine alleinige Behandlung mit H1-Antihistaminika die MCAD-induzierten Beschwerden nicht ausreichend behandelt werden können.
Darmflora und Mastzellerkrankungen
Bei vielen Betroffenen bestehen Probleme im Verdauungstrakt. Welche Bedeutung hat eine Dysbiose (Darm-Fehlbesiedlung) für die Entstehung einer Mastzellerkrankung?
Prof. Molderings: Auch in dieser Frage muß man wieder von einem sehr komplexen Geschehen ausgehen. Ist die Dysbiose Folge der MCAD oder initial Mitursache für eine Manifestation der MCAD. Bei bestehender MCAD mit Darmsymptomatik kann davon ausgegangen werden, dass sich mit der Zeit ein Verschlimmerungskreislauf am Darm etabliert. Die Mastzellaktivierung im Darm führt zu einer durchlässigeren Darmschleimhaut, medizinisch leaky gut genannt. Das begünstigt das Eindringen von Bakterien oder allgemein gesagt Fremdstoffen in den Körper, die dann über eine Aktivierung des Immunsystems mit den Mastzellen als Dirigenten neutralisiert werden müssen. Die Folge ist also eine Mastzellaktivierung, die dann wieder das Entstehen und die Unterhaltung des leaky gut begünstigt und so schließt sich der Verschlimmungskreis.
Anmerkung der Redaktion: Da die Darmgesundheit und die Mastzellaktivität eng miteinander verbunden sein können, können sowohl die Mastzellstabilisierung, wie auch der Aufbau einer gesunden Darmflora, wichtige Rollen bei gesteigerter Mastzellaktivität einnehmen.
Literaturempfehlung
Unbezahlte und unbeauftrage Werbung.
Zusammen mit Univ.-Prof. Dr. med. Martin Mücke veröffentlichte Prof. Molderings 2023 den Ratgeber „Die systemische Mastzellerkrankung“ mit vielen Infos rund um das Thema Mastzellerkrankungen.
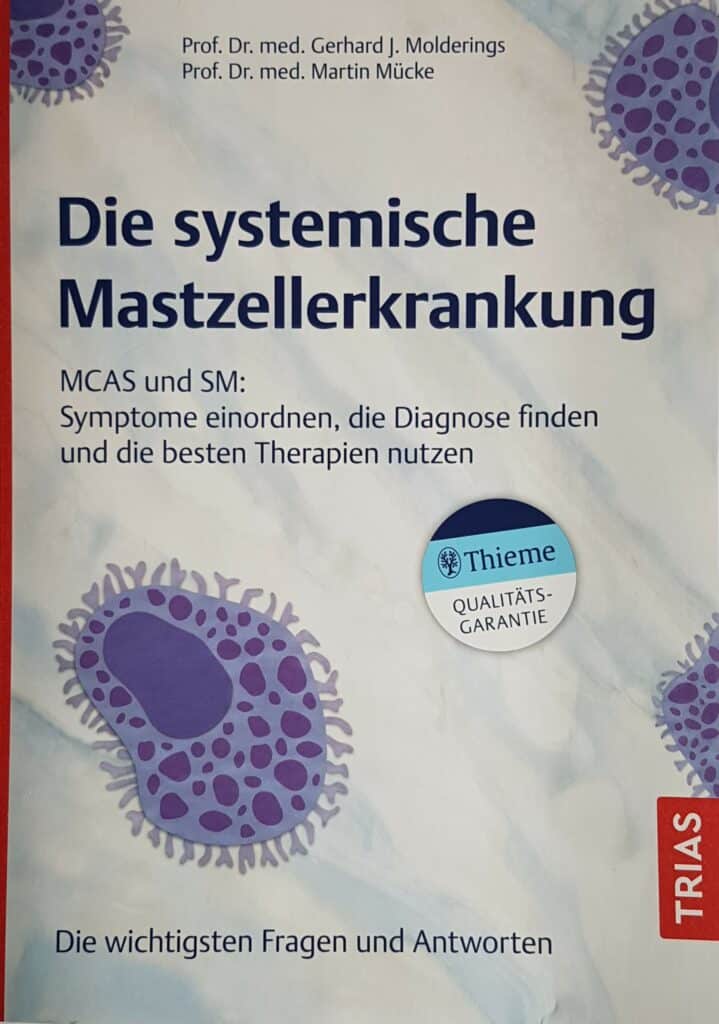
Die systemische Mastzellerkrankung
MCAS und SM: Symptome einordnen, die Diagnose finden und die besten Therapien nutzen . Die wichtigsten Fragen und Antworten
Gerhard J. Molderings, Martin Mücke, TRIAS-Verlag, ISBN: 9783432117645
Bildquelle: Prof. Molderings
Du wirst als Erstes informiert, wenn wir neue Produkte haben, es neue Artikel im Science Blog gibt oder wenn eine Rabattaktion stattfindet.
Kommentare
Füge einen Kommentar hinzu
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenUm den Inhalt von TrustIndex zu sehen, bitte unten klicken. Dabei werden Daten an Drittanbieter übermittelt.
Weitere InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen

Toller Beitrag und so hilfreich! Danke 🙏🏻
Es wäre klasse wenn die „Schulmedizin“ da endlich mal aufgeklärter wäre!